Manuel S. beschreibt, wie er seinen 18. Tag in der Klinik Südhang erlebt.




Das Therapiemodul «Rückfallmanagement«
Zur Vorbereitung aufs Wochenende hatten alle am letzten Freitag für sich festgehalten, was am Wochenende läuft und was er oder sie unternehmen will. Damit stellten wir einen persönlichen Stundenplan zusammen mit den geplanten Aktivitäten. In einem zweiten Schritt und mithilfe eines Ampelsystems wurde das Gefahrenpotential aller Situationen beurteilt: mit Grün markierte ich alle Situationen, die eigentlich nicht heikel sein sollten. Orange angestrichene Situationen hingegen, bergen ein gewisses Gefahrenpotential. Rot sind die heiklen Momente: hier findet die sogenannte Exposition statt. Das heisst, ich begebe mich in eine Situation, in der ich früher immer viel konsumiert habe. Nun schauen wir zurück, ob es Schwierigkeiten gab und ob unsere Einschätzungen richtig waren.


Der Infoanlass «Stressregulation»
Für viele Leute im Saal ist Stress ein Thema. Stress bei der Arbeit, Stress in der Partnerschaft oder mit ihren Kindern. Manche haben auch finanziellen Stress. Die Therapeutin erklärt, woran in den beiden Therapiemodulen «Stressregulation» und «Stressbewältigung» gearbeitet wird. Der Infoanlass heute Morgen dient dazu, dass wir uns entscheiden können, ob wir das Thema vertiefen wollen oder nicht. Wer diese Module belegt, wird für sich analysieren, welche Situationen Stress auslösen. Und er oder sie wird Techniken kennenlernen und üben, um da wieder gesund herauszukommen. Ich erfahre, dass innerer Stress oft zu Rückfällen führt.






Das Offene Atelier
Ehrlich gesagt: zuerst war ich skeptisch in Bezug auf dieses Angebot. Beim ersten Mal hat uns eine Betreuerin unsere Möglichkeiten vorgestellt, falls wir während unserer Behandlung hier in der Klinik kreativ sein wollen. Dabei kam mir in den Sinn und ich hatte es schon fast vergessen, dass ich als Schulbueb Handarbeiten wählte und nicht Werken. Weil ja die Mädchen im Handarbeiten waren! Und ich erinnerte mich, dass ich damals auch in meiner Freizeit gestrickt habe. Also nahm ich das wieder auf und begann hier in der Klinik wieder mit dem Stricken. Nur leider war das Resultat nicht so schön, denn ich strickte viel zu eng. Darum beschloss ich, das Häkeln auszuprobieren. Dabei merkte ich, dass mir das besser liegt. Seither bin ich ganz produktiv: bis jetzt habe ich zwei Mützen, eine Babydecke aus Quadraten, ein Halstuch für mich und eins für meinen Hund gehäkelt.
Nun bin ich noch an einer richtigen Decke, in einem Stück, nicht in Quadraten. Sie wird ca. ein Meter lang. In meiner Verwandtschaft gibt es viel Nachwuchs. Die muss noch fertig werden bis zum Abschluss meiner Therapie. Inzwischen ist das Häkeln meine Art von Achtsamkeitsübung. Ich kann es vor dem Fernseher machen, oder an der Sonne. Und ich will es beibehalten.
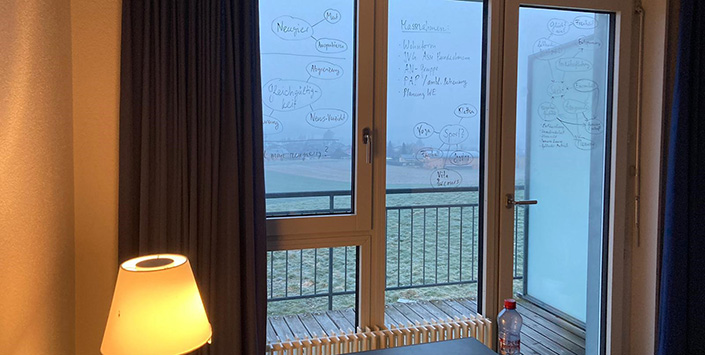

Die Wohngruppe – eine Gemeinschaft im selben Boot
Einmal pro Woche habe ich eine Einzeltherapie. Alle anderen Therapien finden in der Gruppe statt, es ist eine Schicksalsgemeinschaft. Hier in der Klinik ist es so: wir sind alle im gleichen Boot. Das schafft eine Basis. Ausserhalb der Klinik hat man eine Gruppenzugehörigkeit. Hier drinnen fällt die weg. Das ist eigentlich schön. Mit dem Akt, hier einzutreten, zeigen sich alle Patient*innen verletzlich. Ein Eintritt in die Klinik ist ein Statement. Es lautet: «Ich habe es nicht im Griff.» Dass wir uns das alle eingestanden haben, schafft eine Basis und ist wohl Grund dafür, dass die Leute sorgfältig miteinander umgehen. Ich jedenfalls habe jetzt nie eine Aggressivität erlebt.
Etwas vom Schwierigsten an der Sucht ist, dass man ehrlich ist und das Problem nicht für sich behält. Hier in der Klinik sind wir angehalten, ehrlich zu sein, denn es ist Teil des Prozesses. Sich eine Sucht einzugestehen ist schmerzhaft. Man weiss, man hat versagt, es hat nicht funktioniert – und man schämt sich dafür. Darum spricht man am liebsten mit niemandem darüber.
Wer hingegen bereit ist, über seine Sucht zu sprechen, hat bereits den ersten Schritt gemacht. Er oder sie will etwas ändern. Offen darüber zu sprechen braucht Überwindung. Früher habe ich ausschliesslich mit meinem Therapeuten über meine Schwächen oder beispielsweise Rückfälle gesprochen. Inzwischen kann ich das auch in der Gruppe. Das stimmt für mich, weil ich mir dabei angewöhne, offen über Probleme zu sprechen. Andere haben mehr Mühe damit. Aber wenn man es nicht schafft, in einer Gruppe von suchterkrankten Menschen über Sucht zu sprechen, dann geht das anderswo noch weniger.
Was mich freut: ich habe mit einem anderen Patienten eine Vertrauensebene etabliert. Wir treffen uns nun wöchentlich, um genau das zu machen: sich ehrlich auszutauschen. Das wollen wir beibehalten.
Bei anderen Leuten, bei Freunden, bei Verwandten halte ich mich zurück mit meiner Offenheit. Ich will nicht, dass sie sich Sorge machen. Und ich will auch nicht mein Umfeld mit meinen Problemen belasten – zumindest nicht, solange ich in Behandlung bin. Darum bin ich ja auch in Therapie, dass ich daran arbeite und mich mit dem Kernproblem auseinandersetze. Darum muss ich nicht gleichzeitig auch noch mit Freunden ständig darüber sprechen. Einmal ist dann auch genug.
Die Frage beim Austritt wird sich jedoch stellen: mit wem kann ich nun über meine Suchtproblematik sprechen? Da muss ich noch eine Lösung finden. Da kann mir auch niemand helfen, denn jeder muss das mit sich selber ausmachen.












